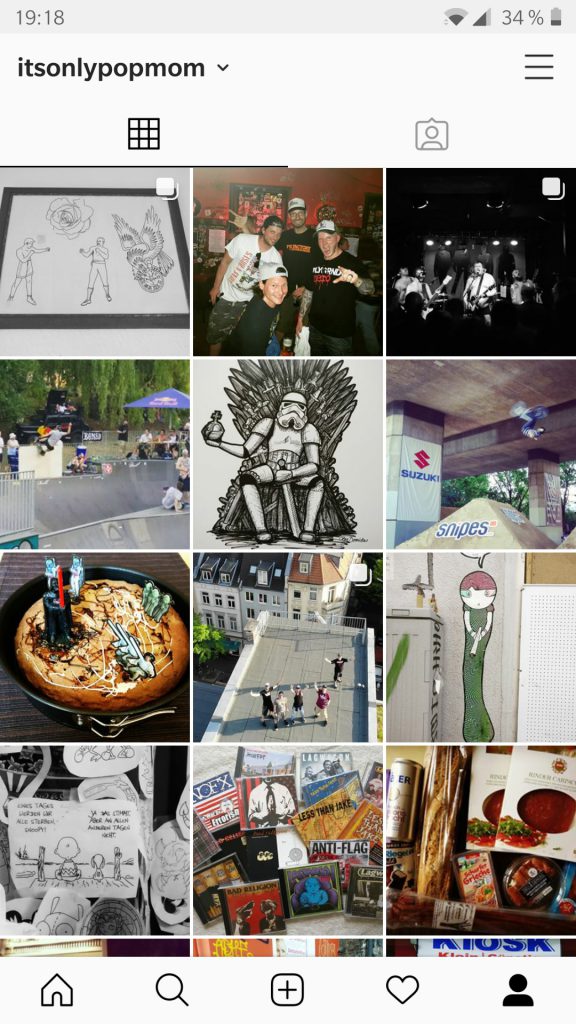Spiegel Online veröffentlichte gestern einen Artikel im Rahmen ihrer UNISPIEGEL-Rubrik, in dem Kim aus Frankfurt, 20 Jahre alt, ein wenig von sich erzählt. Dass sie in London ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht hat, die Schule schmiss, durch Asien reiste. Ihre Stationen zeichnet sie anhand von Tätowierungen nach; vor allem in Asien ließ sie sich mehrere traditionelle Tattoos stechen, unter anderem in Kambodscha und auf den Philippinen.
Dies alles ist noch nicht so ungewöhnlich, wenn auch natürlich nicht alltäglich. Dass sich Kim auch die Finger tätowieren ließ, ist schon exotischer. Der Gund meines Artikels hier ist aber auch das nicht, sondern (mal wieder) die Kommentarsektion bei SPON. Beeindruckend oder beängstigend viele Leser äußern sich dort massiv abwertend. Sie kritisieren Kims Aussehen (auch jenseits der thematisierten Tattoos), haben Angst um ihr Geld, falls Kim nach ihren Reisen dem Staat auf der Tasche liegen sollte, und nörgeln an allen möglichen weiteren Dingen herum.
Was haben Tattoos an sich, dass sie bei manchen Menschen so unvernünftig negative Reaktionen auslösen? Tattoos schaden in der Regel niemandem, halten keinen davon ab, im Job produktiv zu sein, und sind vor allem Privatsache. Aber ruhig Blut, man könnte jetzt ja seitenlang weiterschreiben.
Jedenfalls habe ich als Gegengewicht erstmals selbst einen Kommentar unter einem SPON-Artikel geschrieben. Ich teile diesen hier sicher nicht, weil ich ihn für besonders brillant halte. (Zumal ich mich darin nicht nur auf den Artikel, sondern auch auf andere Leserkommentare beziehe.) Im Gegenteil ist er völlig aus der Hüfte geschossen: Runtergeschrieben, noch einmal durchgelesen und weggeklickt. Ich möchte trotzdem, dass der ein oder andere Denkansatz auch außerhalb des Kommentardickichts auf SPON zu lesen ist:
„Was Kims angebliche Qualifikationslosigkeit angeht, die so viele hier ansprechen: Im 1. Absatz erwähnt sie ein Praktikum, das sie in London bei einem Fotografen gemacht hat. Das kann eine gute Voraussetzung für einen weiteren Weg in diese Richtung sein. Tattoos an Händen und wo auch immer können dabei völlig irrelevant sein.
Wünschenswert wäre, wenn Tätowierungen generell für die berufliche Laufbahn unerheblich wären. Was haben Verzierungen der Haut mit Leistung im Beruf zu tun? Warum kann man nicht als Bankangestellter sichtbar tätowiert sein? Weil es unseriös wirkt? Warum wirkt es unseriös? Weil diese Vorstellung einfach in den Köpfen existiert und auch kaum abgebaut wird, wenn man sie als allgemeingültig hinnimmt und weitergibt. Tätowierungen verweisen heutzutage nicht mehr auf einen Gefängnisaufenthalt. Im Klartext: Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Menschen mit Tätowierungen anders behandelt werden sollten (etwa wenn sie bestimmte Jobs nicht bekommen, nur weil sie tätowiert sind), als untätowierte Menschen. Es ist nur Farbe auf der Haut.
Hier wird auch kritisiert, dass Kim außer Tattoos wohl nicht viel erlebt hätte, weil sie nur davon berichtet, bzw. ihre Reisen werden darauf reduziert. Aber die Reisetätowierungen sind nun mal das Thema des Artikels! Sie hätte wahrscheinlich auch andere Aspekte hervorheben können; über so viele Reisen ließe sich sicherlich seitenlang mit diversen Schwerpunkten berichten. An dieser Stelle stehen aber die Tattoos im Mittelpunkt. Das ist redaktionell völlig nachvollziehbar. Schließlich ist es zwar nicht einzigartig, solche traditionellen Tätowierungen auf Reisen zu sammeln, aber eben auch nicht alltäglich. Keiner der Weltreisenden, die ich kenne, hat dies gemacht.
Auf ihr Praktikum habe ich bereits hingewiesen; dass Kim auf ihren Reisen gejobbt hat, ist vielen ja aufgefallen. Ein Kommentar hob jedoch sarkastisch hervor, dass sie sich in Jakarta eine Wohnung mietete, um einem Tätowierer bei der Arbeit „zuzusehen“. Dabei erwähnt sie allerdings auch: „[…] wir haben das Studio jeden Morgen geputzt.“ Das lässt vermuten, dass sie in dem Laden mitgearbeitet hat, als Shopgirl (=Assistentin der Tätowierer) etwa. Übrigens ein Job, den es auch in Deutschland in den unzähligen Tattoostudios gibt.
Ein Wort zu Tattoos und Alter: Gähn. Nein, im Ernst, das ist ein so banaler wie ungenauer Vorwurf. Man sollte sich zuerst alte Menschen mit Tattoos ansehen. Möglichst mit qualitativ hochwertigen – da hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan, was die Qualität (Beständigkeit etc.) der Farben angeht sowie die Fähigkeiten der Tätowierer. Aber das ist ein so weites Feld; es lohnt sich, sich damit ein wenig zu beschäftigen, anstatt stumpf die gleichen undifferenzierten Phrasen zu dreschen. Im Übrigen: Haut hängt im Alter überwiegend nicht fleischlos zentimeterweit vom Körper herab. Und wer bunte alte Haut nicht mag, wird unbunte (evtl. blasse, fleckige) alte Haut wahrscheinlich nicht viel positiver beurteilen.
Wenn gegen Tattoos ins Feld geführt wird, dass sie selbst ja inzwischen eigentlich völlig spießig wären, weil ja jeder „Dorfdepp“ welche habe (gerne werden in diesem Zusammenhang auch „heimlich“ tätowierte Bankangestellte erwähnt, die sich durch ihre Tätowierungen beweisen müssten, dass sie ja gar nicht so spießig seien, wie sie es eben doch wären), dann kann man vermuten, dass Tattoos doch noch eine gewisse Sprengkraft haben. Und Manche, die untätowiert sind, auf irgendeine Art so reizen, dass sie aus allen Richtungen gegenschießen. Denn es ist ja paradox: Erst werden Tätowierungen verteufelt, weil sie ein Merkmal des Asozialen seien, dann wird versucht, ihnen das kritisierte Rebellische abzusprechen, indem auf „Normalbürger“ (deren Spießbürgertum dann abwertend dargestellt wird) verwiesen wird, die durch Tattoos zwar vielleicht ihrem Leben einen rebellischen Anstrich geben wollten, damit sich aber nur selbst etwas vormachen würden.
Tatsache ist: Immer mehr Menschen haben Gefallen an Tätowierungen, aus unterschiedlichsten Gründen. Manche laden ihre Tattoos mit persönlichen Bedeutungen auf, manche wollen nur bestimmte Verzierungen haben, manche sammeln sie als Reisesouvenirs. Menschen lassen sich seit Jahrtausenden aus unzähligen Gründen tätowieren; schon Ötzi war tätowiert (wohl aus medizinischen Gründen). Im europäischen Adel des 19. Jahrhunderts galten Tattoos als schick, in China wurden Kriminelle damit markiert. Was sagt uns das? Nur, dass es keine räumlich oder zeitlich allgemeingültigen Hintergründe für dieses Kunsthandwerk gibt.
Abschließend würde ich gerne für mehr Toleranz, Offenheit und Gelassenheit plädieren. Niemand weiß, welchen Weg Kim einschlagen wird. Es geht auch niemanden außer Kim etwas an. Erst Recht geht es niemanden etwas an, wie ein Mensch seinen Körper gestaltet. Ästhetische Vorlieben können völlig unterschiedlich sein. Es ist absurd, auf Basis seiner eigenen Vorstellungen jemanden mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu bewerten.“