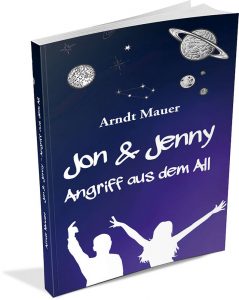Zum im Juli bei Sony Music erschienen Album Ecstasy der Schwaben Kissin‘ Dynamite findet man im Netz haufenweise Besprechungen. Ist auch immerhin schon das sechste Album in der zehnjährigen Bandgeschichte und setzt eine Erfolgsgeschichte fort, die saustarken Hardrock, genauer wohl Glam Metal mit Sleaze-Einschlag, made in Germany beinhaltet.
Wichtigstes Merkmal vom Glam Metal ist die gute Laune, die beim Hören von stadiontauglichen Hymnen aufkommt. Ein erhebendes Gefühl, das die Faust in die Luft befördert. Das ganze unterfüttert von treibenden Gitarren. Lieblich (Pop), aber wild (Rock). Und manchmal ein bisschen bombastisch. Wie die perfekte Freundin. (Oder der perfekte Freund?)
Der Trick dabei, diese in den 80ern verhaftete Spielart der Rockmusik in die Gegenwart zu transportieren, ist ja, in Bezug auf Melodien und Spielfreude den alten Klassikern ebenbürtig zu sein, produktionstechnisch aber frisch aus den Boxen zu knallen. Kissin‘ Dynamite – allein der Name! – liefern da gekonnt ab.
Melodien können sie, auch wenn Bon Jovi vielleicht noch nicht erreicht werden. Gesang, Instrumente, alles tadellos. Und trotz betagtem Genre klingt das Gesamtpaket so lässig und stimmig, als würde in Deutschlands Radios nichts anderes laufen, sprich als würde jeder hier von klein auf damit groß. Nimm das, Mainstream! Also wortwörtlich.