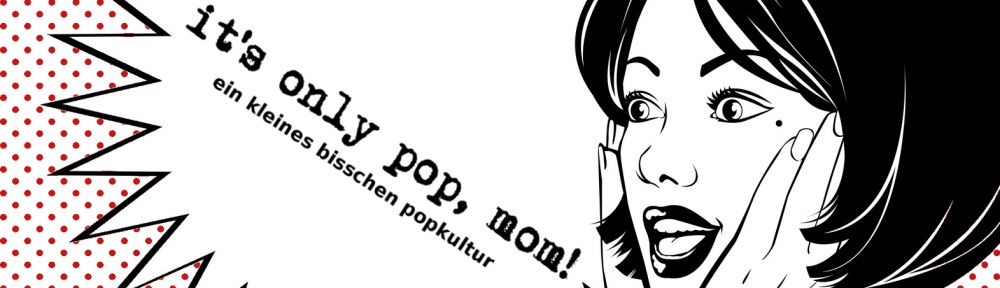Endlich – die siebte Staffel von The Walking Dead hat die Streamingdienste erreicht. Spannung bis in die entlegensten Nervenenden, unappetitliche Untote und … selbst Beißer bändigende Monologe. Diese so unvorstellbar harte Welt, in der die Menschen nach dem Beginn der Zombie-Epidemie überleben müssen, scheint sie nicht nur zu Nahkampfexperten, sondern auch zu reinrassigen Rhetorik-Recken gemacht zu haben.
Schweres Geschütz kommt zum Einsatz: Längst vergangene Ereignisse werden einnehmend vorgetragen und unvermittelt in einen neuen Kontext gesetzt, um einen augenöffnenden Kommentar zur aktuellen Situation zu liefern. Verbindungen zwischen Begebenheiten gezogen, die den Weg in die Zukunft weisen sollen. Absichten anhand von Gleichnissen vermittelt.
Mal ehrlich. Wer von uns kann schon aus dem Nichts derart bedeutungsschwangere Reden unfallfrei vortragen? Minutenlang? Kein Verhaspeln, kein Nachdenken. Kein „Ähm, weißte, was ich meine?“
Klar, diese Monologe, teils auch als Dialoge getarnt, stellen den Gegenpol zu der heftigen Gewalt dar. Sie sollen dem ganzen Gewicht geben. Taten mit Bedeutung aufladen und Emotionen intensivieren. The Walking Dead nutzt dieses Mittel sicher nicht exklusiv, hier ist es mir aber besonders aufgefallen. Denn sie übertreiben es schlicht ein wenig. Extreme Gewalt und Brutalität sollte nicht mit extrem tiefschürfenden Reden kontrastiert werden. Jedenfalls nicht zu oft. Denn während das eine krass, aber glaubwürdig ist, ist es das andere nicht. So spricht kaum jemand. Ja, es sind besondere Zeiten, durch die diese Figuren wandeln. Und außer ihren Gedanken haben sie nicht mehr viel.
Dennoch – Zombies als Rhetorikkatalysatoren? Stellt euch an dieser Stelle statt weiterer Worte einen skeptischen Gesichtsausdruck à la Daryl Dixon vor. Also einfach seinen normalen Gesichtsausdruck.
Hoffentlich überleben er, Rick und co. noch eine Weile, damit wir weiterhin bei ihren Reden mit den Augen rollen können. Zur Erholung von der zombieszerfetzenden Spannung …